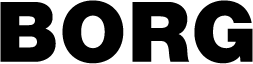Borg/borg
Texte/texts
Ausstellungen/expositions
Publikationen/publications
Bibliographie/bibliography
Lebenslauf/curriculum vitae
Impressum/imprint |
Texte/texts
BORG bin ich/BORG IS ME
Entwurf für Borg/A draft for BORG
Schluesselfertig/Turnkey
|
„Geistesblitz“ und „Glück“ - EinBlick ins Gehirn
Für die isländische Künstlerin Inga Svala Thorsdottir stellt Kunst eine Art Neugiersdisziplin dar, bei der es unter anderem um das Entwerfen von Glück, um Erkenntnis durch Geistesblitz und um die Vision einer neuen Stadtgründung – Borg - geht. Was sind eigentlich Korrelate von Geistesblitz und Glück, wenn wir einen Blick ins Gehirn wagen?
Eine intensive Auseinandersetzung mit „wirklich“ wichtigen Fragen kombiniert mit einer kreativen Pause, einem Ortswechsel oder einfach ein wenig „Eigenzeit“ können dazu führen, dass er sich unvermittelt, einfallsartig ins Bewusst-Sein drängt, der Geistesblitz. Mit Heureka! (übersetzt: Ich habe es gefunden!) soll der griechische Philosoph und Mathematiker Archimedes aus dem entspannenden Wassertrog im öffentlichen Badehaus gestürzt und begeistert, voller Elan durch die Straßen von Syrakus gerannt sein. Der Legende zufolge hatte Archimedes dabei herausgefunden, dass sein Körper das Wasser verdrängt. Damit konnte er beweisen, dass die Goldschmiede geschummelt und die goldene Krone des Königs mit Silber gestreckt war.
Der Geistesblitz - gekennzeichnet durch die Kombination aus schlagartigem Erkenntnisgewinn mit ausgeprägtem „Glücksmoment“ - ist seit langem ein großes Rätsel für die Hirnforschung. Mit modernen Techniken wurden in den letzten Jahren Modelle zur Hirnfunktion entwickelt und anhand der dabei ableitbaren Hypothesen auch neurobiologische Mechanismen des „Geistblitz“ untersucht. Ein heute gängige Ansatz zur Erklärung der Hirnfunktion postuliert als Ausgangsbasis eine Interaktion auf unterschiedlichen Ebenen kommunizierender Nervenzellen: Einerseits die so genannten „eloquenten“ Neuronenpopulationen, welche rasch und effizient spezifische Teilaufgaben ausführen (z.B. Gedächtnisfunktionen). Andererseits gibt es weniger differenzierte Nervenzellen, welche u.a. die neuronalen Prozesse dieser „lokalen Spezialisten“ modulieren und global integrieren. Diese liegen in so genannten Assoziationsgebieten im Gehirn, z.B. in Teilen des Schläfenlappen.
Die Kommunikation im Nervensystem vollzieht sich mit Hilfe einzelner elektrischer Schwingungen, die sich entlang der Nervenbahnen von einem Punkt des Netzes zum anderen bewegen, und über biochemische Signale z.B. durch die Neurotransmitter Glutamat, GABA, Dopamin, Serotonin oder Acethylcholin. Die elektrischen Signale stammen aus Impulsgeneratoren, die wie Oszillatoren funktionieren, wobei unablässig das Membranpotential langsam hin und her schwingt bis zum Überschreiten eines Schwellenwertes, der die Auslösung eines Nervenimpulses zur Folge hat.
Wesentlich für die Kohärenz der zentralnervösen Informationsverarbeitung (und damit auch für Problemlöseprozesse wie auch Glücksmomente) ist die exakte zeitlich-räumliche Synchronisation dieses oszillierenden Nervenzellverbände über so genannte Bindungsprozesse. Dabei ist Erregung in bestimmten Hirnbereichen von Hemmung in anderen begleitet, was über Neurotransmitter vermittelt wird.
Auch bei einem Geistesblitz, bei dem das Gehirn die Problemlösung scheinbar anders als sonst im Alltag bewerkstelligt, kommen diese Grundprinzipien der Hirnfunktion in sehr rascher Abfolge zum Tragen: Im rechten Schläfenlappen des Gehirns, der einerseits mit Langzeit- und autobiographischem Gedächtnis zu tun hat, und dabei eine enge Beziehung zum limbischen System („Bauch in unserem Kopf“) unterhält, anderseits Assoziationen schaffende Funktion ausübt, kommt es vor dem Geistesblitz zu einer plötzlichen starken neuronalen Synchonisation und Erregung, während unmittelbar davor gegenwärtige optischen Informationen über Desynchronisation und Hemmung neuronaler Aktivität ausgeblendet werden. Dies lässt sich mit funktioneller Bildgebung ebenso wie über EEG nachweisen. Dieser Prozess ist fein balanciert und exakt zeitlich-räumlich organisiert. Ca. 300 ms vor einem Geistesblitz entstehen im visuellen Kortex niedrigfrequente Wellen, die dann wieder verschwinden, wenn der Schläfenlappen aktiv wird und bestehende Gedächtnisinhalte zu einer neuen Assoziation – dem Geistesblitz - erstmalig und unerwartet verbindet. Auf der Verhaltensebene kommt es zum Erleben von Überraschung, welche wiederum mit dem Dopamin-System in Verbindung steht. Dopamin ist Mediator von Neugierde wie auch Lernen und über das Endorphinsystem auch mit dem subjektiven Erleben des Glücksmoments assoziiert. Ein Geistesblitz erhellt, befriedigt Neugierde und macht glücklich.
Prof. Dr. Dieter F. Braus
|
|
A flash of inspiration and a moment of happiness – insight into the workings of the brain
For the Icelandic artist Inga Svala Thorsdottir, art represents a kind of ‘discipline of curiosity’ which enables her to explore questions such as how concepts of happiness are devised or how insight is gained through flashes of inspiration, and also to develop her vision of founding a new city – Borg. If we dare to take a look inside the brain, what correlates of the ‘flash of insight’ and the ‘moment of happiness’ can actually be observed?
Intense concentration on really important questions followed by a creative pause, a change of location, or simply taking some ‘time for oneself’, can result in the solution suddenly and unexpectedly popping into one’s mind: the flash of insight. Legend has it that, with a cry of “Eureka!” (I have found it!), the Greek philosopher and mathematician Archimedes leaped out of the tub in the public baths where he had been relaxing and ran, elated and jubilant, through the streets of Syracuse. The story goes that while sitting in the bath he had suddenly realised that his body displaced an equal volume of water. This discovery enabled him to prove that the goldsmiths had indeed cheated the King by adulterating his golden crown with silver.
The flash of inspiration – characterised by a very sudden insight accompanied by a distinctive feeling of happiness – has long been an enigma to neuroscientists. Over the past few years, models of brain function have been developed using the most advanced modern techniques; on the basis of hypotheses derived from these models the neurobiological mechanisms of the flash of insight can be examined. A widely accepted current approach to the explanation of brain function takes as its starting point the interaction of communicating nerve cells on different levels. On the one hand there are so-called ‘eloquent’ neuron populations which perform specific partial tasks (such as functions related to memory) quickly and efficiently. On the other there are less differentiated nerve cells which are involved with – amongst other things – modulating and generally integrating the neuronal processes of the ‘local specialists’. These are located in the ‘associative’ regions of the brain, for example in parts of the temporal lobe.
Communication across the nervous system is achieved by the conduction of individual electrical impulses along nerve tracts from one point of the network to the next, as well as by the transfer of biochemical signals (for example by the neurotransmitters GABA, glutamate, acetylcholine, dopamine or serotonin ). The electrical signals are emitted by impulse generators which function like oscillators, causing the membrane potential to switch back and forth slowly and constantly until a threshold limit is reached which triggers a nerve impulse.
An essential requirement for coherent information processing in the central nervous system (and consequently for problem-solving processes and moments of happiness) is the precise spatio-temporal synchronisation of these oscillating cell assemblies by means of so-called ‘binding processes’. These result in excitation in certain regions of the brain being accompanied by inhibition in others: information which is conveyed by neurotransmitters.
These fundamental principles of brain function also take effect – in rapid succession – in the flash of insight, when the brain seems to find the solution to a problem in a different way to usual; in the right temporal lobe, which on the one hand is connected with long-term and autobiographical memory and as such is closely linked to the limbic system (“the stomach in our head”), and on the other performs associative functions, the flash of insight is preceded by a sudden and markedly strong burst of neuronal synchronisation and excitation, while previous visual information about the desynchronisation and inhibition of neuronal activity is suppressed. This can be demonstrated with the aid of functional imaging and EEG measurement. It is a finely balanced process organised according to precise spatio-temporal aspects. Approximately 300 ms prior to a flash of insight, low-frequency waves are produced in the visual cortex, which then disappear when the temporal lobe is activated and existing memory contents are combined unexpectedly to form a completely new association – the flash of insight. On a behavioural level this produces an experience of surprise – the ‘aha!’ moment – which in turn is linked to the dopamine system. Dopamine is the mediator of both curiosity and learning, and is connected by the endorphin system to the subjective experience of happiness. The flash of inspiration not only enlightens us – it also satisfies our curiosity and gives us pleasure.
Prof. Dr. Dieter F. Braus
|
|
|